Künstliche Intelligenz (KI) spielt in vielen Bereichen eine immer größere Rolle: automatisierte Chatbots, Bonitätsprüfungen, Bilderkennung. Doch die DSGVO setzt Grenzen, wenn personenbezogene Daten einbezogen sind. Die DSGVO KI Regelungen umfassen sowohl automatisierte Entscheidungen (Art. 22 DSGVO) als auch die Frage, wie KI-Modelle trainiert werden dürfen. In diesem Artikel erfährst du, wann du eine Datenschutz-Folgenabschätzung brauchst, wieso „Blackbox-Algorithmen“ problematisch sind und wie du faire und transparente KI-Anwendungen entwickelst. So bleibst du innovativ – ohne gegen den Datenschutz zu verstoßen.
Bulletpoints – DSGVO KI Regelungen
- Art. 22 DSGVO: Recht auf menschliche Überprüfung automatisierter Entscheidungen
- DPIA: Bei risikoreicher KI-Anwendung
- Bias-Tests: Prüfe dein Modell auf Diskriminierung
- Erklärbarkeit: Gib Nutzern Einblick in Hauptfaktoren
1. Automatisierte Einzelentscheidungen (Art. 22 DSGVO)
- Bonitätsprüfungen, Kreditscoring: Ein KI-Modell entscheidet, ob jemand kreditwürdig ist.
- Personalrekrutierung: Automatische Vorsortierung von Bewerbungen.
- Versicherungsprämien: Algorithmus berechnet Risiko.
Die DSGVO verlangt, dass Nutzer nicht ausschließlich einer automatisierten Entscheidung unterworfen sind, die erhebliche Auswirkungen hat (z. B. Ablehnung eines Kredits). Sie haben das Recht auf menschliche Überprüfung.

2. Profiling und Transparenz
Profiling ist jede automatisierte Verarbeitung, um persönliche Aspekte (z. B. Vorlieben, Verhalten) zu bewerten. KI-Systeme generieren daraus Vorhersagen. DSGVO fordert:
- Information: Betroffene müssen wissen, dass ein Profiling stattfindet.
- Berechtigtes Interesse oder Einwilligung: für Marketing-KI oder Risikobewertungen.
- DPIA (Datenschutz-Folgenabschätzung): Bei hohem Risiko.
3. Training von KI-Modellen
- Datensparsamkeit: Sammle nur so viele Daten, wie nötig sind, um das Modell zu trainieren.
- Anonymisierung oder Pseudonymisierung: Reduziert das Datenschutzrisiko.
- Bias und Fairness: Prüfe, ob dein Modell unbewusste Diskriminierung enthält (z. B. schlechtere Kreditvergabe an bestimmte Gruppen).
4. Dokumentation und Erklärungspflicht
Die DSGVO fordert im Sinne der Transparenz, dass du zumindest in Grundzügen erklärst, wie KI-Systeme zu ihren Entscheidungen kommen. Eine vollständige Offenlegung jedes Algorithmusdetails ist oft technisch unmöglich, aber Betroffene sollten verstehen, auf welchen Merkmalen Entscheidungen basieren.
5. Häufige Stolperfallen in den DSGVO KI Regelungen
- Keine DPIA: Bei sensiblen Daten oder großem Profiling ist eine Datenschutz-Folgenabschätzung Pflicht.
- Mangelnde Einwilligung: Wenn KI Daten für personalisierte Werbung sammelt, braucht es meist ein Opt-in.
- Diskriminierende Datensätze: KI lernt aus vergangenen Vorurteilen (Bias), was zu ungewollter Ungleichbehandlung führen kann.
- Keine Auskunft über Algorithmen: Betroffene haben das Recht auf Info, wie die Entscheidungen grob zustande kommen.
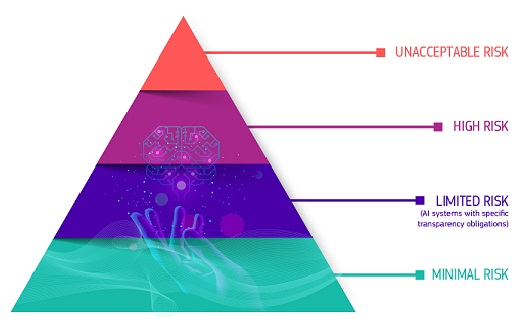

FAQ – DSGVO KI Regelungen
Nein, bei wesentlichen Entscheidungen (z. B. Einstellung, Kreditzusage) musst du zumindest eine menschliche Schlussprüfung ermöglichen.
Nicht bis ins letzte Detail, aber die Logik und wesentlichen Kriterien solltest du erläutern, damit Betroffene das Ergebnis nachvollziehen können.
Achte auf mögliche Urheberrechte und DSGVO-Aspekte (z. B. Einwilligung der Personen, Datensparsamkeit). Anonymisiere, wo möglich.




